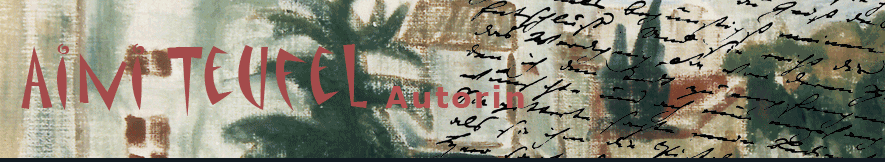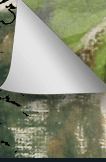Versuch, auszutreten aus Bildern,
die andere malten
Italien-Tagebuch 1992
• Einführung - Leseprobe •
 Durch die Vereinigung Deutschlands wurde es mir 1992
möglich, eine Studienreise nach Italien zu unternehmen. Dieses Land nun als
beinahe Sechzigjährige erlebend, wähnte ich mich fortwährend in Bildern, die
andere Künstler – vor allem die französischen Impressionisten und Fauvisten -
gemalt hatten, denn, gefangen in der Enge unseres kleinen Landes DDR, wurden
für viele von uns die Bilder anderer Maler zu Welten, zur „Außenwelt“. Die
Schwierigkeit bei meiner ersten Reise nach Italien bestand für mich darin,
„herauszutreten“ aus den Bildern anderer, um die Wirklichkeit zu begrüßen und
einzutreten in eine noch nicht künstlerisch geordnete Welt, um diese nun zu
ordnen zum neuen, ganz eigenen Bild.
Durch die Vereinigung Deutschlands wurde es mir 1992
möglich, eine Studienreise nach Italien zu unternehmen. Dieses Land nun als
beinahe Sechzigjährige erlebend, wähnte ich mich fortwährend in Bildern, die
andere Künstler – vor allem die französischen Impressionisten und Fauvisten -
gemalt hatten, denn, gefangen in der Enge unseres kleinen Landes DDR, wurden
für viele von uns die Bilder anderer Maler zu Welten, zur „Außenwelt“. Die
Schwierigkeit bei meiner ersten Reise nach Italien bestand für mich darin,
„herauszutreten“ aus den Bildern anderer, um die Wirklichkeit zu begrüßen und
einzutreten in eine noch nicht künstlerisch geordnete Welt, um diese nun zu
ordnen zum neuen, ganz eigenen Bild.
DR. ELVIRA ZÖLLNER:
Auch Tagebuchaufzeichnungen aus jüngster Zeit lassen aufmerken. Die Reisemöglichkeiten nach der Vereinigung Deutschlands bieten neue Chancen zu Besinnung, zu Reflexionen über vergangenes und Gedanken über zukünftiges Leben. Bisher nicht gekannte Einblicke ermöglichen, die eigene Vergangenheit in andere Zusammenhänge zu stellen, schenken zuweilen Antworten auf Fragen, mit denen man Jahrzehnte lebte, zwingen, einiges neu zu ordnen im persönlichen Lebensbild. Im November 1988, als in Dresden-Prohlis zum ersten Mal ein Programm des Westfernsehens zu empfangen war, schrieb Aini Teufel:
Immer öfter frage ich mich: woher nimmt eigentlich jemand das Recht zu entscheiden, dass ich die Welt nicht sehen darf? Ich habe auch nur ein einziges Leben. Meine Mutter Elisabeth war in ihrer Jugend auf Wanderschaft und hat sich die Welt angeschaut, sich eine „Weltanschauung“ erworben. Meiner Generation ist das verwehrt. Uns prägte die Enge und wurde möglicherweise, ob wir es wollen oder nicht, zur Enge in uns. Als Maler Italien nicht zu kennen, nicht Griechenland, nicht Paris, das verkrüppelt. Wie anders hätten wir werden können?
Leseprobe
6. SEPTEMBER 1992
 Lichtkaskaden über morgendunklen Bergen. Vor den
Bergen Nebelschleifen, die, von Licht getroffen, zu leuchten beginnen. Die
Berge schweben. Breiter werdende Nebelbänder, durchsichtiger wachsen sie zu
schwebendem Licht, aus dem Bergspitzen ragen. Auf der anderen Seite der
Autostraße hohe schneeweiße Gebirge.
Lichtkaskaden über morgendunklen Bergen. Vor den
Bergen Nebelschleifen, die, von Licht getroffen, zu leuchten beginnen. Die
Berge schweben. Breiter werdende Nebelbänder, durchsichtiger wachsen sie zu
schwebendem Licht, aus dem Bergspitzen ragen. Auf der anderen Seite der
Autostraße hohe schneeweiße Gebirge.
Südtirol. Kleine Ortschaften mit Kirchen, geduckt zu Füßen bewaldeter Berge. Eng und dunkel die Täler, gewaltig die ferne Felsenkulisse der Dolomiten. Die Täler weiten sich mehr und mehr. Die Hänge sind höher hinan besiedelt.
Verona, mittags. Erdfarben und weiß. Gebrochenes Dunkelgrün die aufstrebenden Zypressen und Pinien, deren Schirme Schatten schenken. Laufen durch einen Park. Springbrunnen. Auf Bänken Lesende, Sinnende. Zwischen den Ästen der Bäume schon sichtbar: das Amphitheater aus dem ersten Jahrhundert nach Christi. Wie benommen tasten die Füße auf dem glänzend glatten Marmor der Stufen entlang. Hat man die Sonne gefangen in dieser marmorglänzenden riesigen Schale? Wir tapsen und stolpern ihr entgegen, hinan auf noch helleren Stufen, hinan!
Die Toskana, halb sieben am Abend. Eine weißliche Mondscheibe hängt am blassblauen Himmel. Im Busfunk, leise, Gitarrenmusik. Mediterrane Landschaft nun. Nachdenken: Wir dürfen reisen. Das ist noch nicht ganz begreifbar, wir sind noch nicht ganz hier. Nachdenken: In uns ist Liebe gewachsen zu jenen Ländern, in die zu reisen uns möglich war. Ich bringe diese Liebe mit nach Italien. Glaube, manche von uns verraten sie. Mich friert innerlich, wenn ich höre, wie man darum bittet, als arm bemitleidet zu werden. Wird man nicht dadurch erst arm?
7. SEPTEMBER 1992
Florenz. Der Piazzale Michelangelo hoch über der Stadt. Taumeln, ungläubig, in
ein Meer warmen Lichtes. Schauen, hinab auf ein aus Morgendunst erwachendes
Kunstwerk vergangener Zeit. Still, vornehm ruht es in sich, hat es nicht nötig,
sich darzubieten. Stille Schönheit als Wert! Wunderbar, wie wortlos dieses
Panorama mit seinen verhaltenen Farben uns in Frage stellt, uns und unsere
laute Zeit! Noch sind wir neuen Bundesbürger Florenz um eine Winzigkeit
verwandter als Bürger der alten Bundesländer. Wie lange noch? Versuch, ein
Empfinden zu fassen: In uns, beim Anblick dieser Stadt ist mehr als Freude, sie
zu sehen. Sie spricht uns an in Problemen, in die wir - uns - stürzten und aus
denen wir noch nicht fanden. Florenz macht Mut.
Laufen im Gänsemarsch auf schmalen Fußwegen. Enge Straßen, die Autos fahren im Schritt. Ich fürchte mich ein wenig davor, zum ersten Male echte Giottos zu sehen. Man gewinnt den Eindruck, Welten sind unterwegs zu ihnen. Bilder und wieder Bilder - man schaut und ahnt, dass dieser Zustand des Ertrinkens genommen werden muss als unabänderlich. Dennoch: Es ist etwas Unerhörtes geschehen: man hat sie gesehen, Bilder, die man brauchte und noch braucht. Sie gehören uns auf andere Art als vorher. Und auch wir sind nicht mehr die gleichen wie vorher.
Laufen im Gänsemarsch auf schmalen Fußwegen. Enge Straßen, die Autos fahren im Schritt. Ich fürchte mich ein wenig davor, zum ersten Male echte Giottos zu sehen. Man gewinnt den Eindruck, Welten sind unterwegs zu ihnen. Bilder und wieder Bilder - man schaut und ahnt, dass dieser Zustand des Ertrinkens genommen werden muss als unabänderlich. Dennoch: Es ist etwas Unerhörtes geschehen: man hat sie gesehen, Bilder, die man brauchte und noch braucht. Sie gehören uns auf andere Art als vorher. Und auch wir sind nicht mehr die gleichen wie vorher.
9. SEPTEMBER
Fahren nach Rom im Nebellicht. Bergketten stehen in Schichten wie Kulissen. Ein
römisches Aquädukt. Pinien am Straßenrand und Palmen. Aus grünen Wedeln fluten,
wie orangene Springbrunnen, Büschel zarter Blütenstäbe. Dahinter - als
mattsilbernes Band - das Tyrrhenische Meer. Ein Straßenschild: ROMA. Es
schauert mich.
10. SEPTEMBER
 Rom. Morgenblau verhaltene Farbigkeit. Laufen,
vorsichtig, in der Antike. Da stehen vor uns, um uns, ruhend in sich seit
unfassbaren Zeiten, in Sepiatönen, gebaute Welten, die einen fangen durch das
Maßverhältnis ihrer architektonischen Komposition, das man auf irgendeine Weise
wohl als Sehnsucht in sich trug, das man erwartete, ohne davon zu wissen. Jetzt
ist es da. Das verwirrt wie alle sich erfüllenden Träume. Versunkene Welt? Ich
kann mir nicht klar werden, ob die antiken Ruinen die damals erfundene Musik
der Formen nicht deutlicher darbieten als die vollständigen Gebäude, die sie
einst waren. Capitol, Forum Romanum - Begriffe, die man kannte und ordnete als
nicht allein Jahrhunderte, sondern als ewig entfernt von uns Bürgern der DDR.
Rom. Morgenblau verhaltene Farbigkeit. Laufen,
vorsichtig, in der Antike. Da stehen vor uns, um uns, ruhend in sich seit
unfassbaren Zeiten, in Sepiatönen, gebaute Welten, die einen fangen durch das
Maßverhältnis ihrer architektonischen Komposition, das man auf irgendeine Weise
wohl als Sehnsucht in sich trug, das man erwartete, ohne davon zu wissen. Jetzt
ist es da. Das verwirrt wie alle sich erfüllenden Träume. Versunkene Welt? Ich
kann mir nicht klar werden, ob die antiken Ruinen die damals erfundene Musik
der Formen nicht deutlicher darbieten als die vollständigen Gebäude, die sie
einst waren. Capitol, Forum Romanum - Begriffe, die man kannte und ordnete als
nicht allein Jahrhunderte, sondern als ewig entfernt von uns Bürgern der DDR.
Ich sehe, unser Reiseleiter, lehnend am Geländer, wartet auf uns, damit wir seine Worte hören. Man drängt zu ihm. Ich bin nicht fähig zu gehen. Eine Welt spricht zu mir, ich muss ihr lauschen. Nur so finde ich mein Rom.
Das Kolosseum - gewaltig wächst es um uns auf; von jedem Blickpunkt aus bieten sich andere Kompositionen. Wollte man hier malen oder zeichnen, bedürfte es keiner Mühe, Kompositionselemente in eine Bildordnung zu bringen. Ja, es begegnen einem, wo man auch steht, schon geordnete Bilder, man lebt, bewegt sich in einem Kunstwerk! Und immer wieder empfindet man diese architektonischen Kompositionen zugleich als Tafelbilder, in die Blick und Gefühl hinein- und wieder herausgeführt werden. Wobei die eben geschaute Bildform im eben geschauten Ensemble plötzlich zum neuen Bildteil eines neu sich bietenden Ensemble wird. Ausgeliefert diesen sich ständig wandelnden Wertigkeiten, weiß man nicht: schaukelt man selbst, oder schaukelt die Welt?
Nachmittags zum Pantheon. Dieser merkwürdig düstere Rundbau, oben offen, soll das am besten erhaltene Bauwerk der Antike sein. Mich jedoch zieht es aus dieser grabähnlichen Kühle zu den Menschen der Stadt.
Ich erlebe sie am Abend, als wir durch warmes, lichterfülltes Dunkel gehen; - alle Menschen von Rom scheinen unterwegs zu sein. Und dann, unvermittelt, sehen wir die Spanische Treppe. Im Lichte unzähliger Ampeln gewahrt man nur Menschen; auf Stufen Lagernde, Sitzende, Schwatzende, Essende, Trinkende, hört sie singen und sprechen in vielen Sprachen. Welch überwältigendes lebendes Bild zu beinahe mitternächtlicher Stunde! Welch wunderbares Sozialverhalten, einander so offensichtlich und selbstverständlich zu bedürfen! Und unten, wo die Spanische Treppe beginnt, ein Brunnen mit Fontänen, auf den Rändern des Brunnens Plaudernde. Wie im Traum bewegen wir uns - meine Freundinnen und ich - zwischen den Jugendlichen die Stufen hinauf, werden angelächelt und lächeln zurück. Stehen dann oben und schauen hinab ins Gewimmel. Das ist, was ich lange suchte, irgendwann nicht mehr suchte und mir einfach erfand in Geschichten, die niemand druckte, weil niemand sie glaubte. Ich könnte lachen und lachen: Es gibt, was ich für möglich hielt!
12. SEPTEMBER
Pompeji. Zwischen Zypressen und Palmen und haushohen, blühenden Oleanderbäumen.
aufstrebend vor dem Blau des italienischen Himmels die weißen und erdfarbenen
dorischen und ionischen Säulenensemble, Reste von Tempeln und Altären. Doch
auch Verkaufsläden und Wohnhäuser, Torbögen, Thermen sind erhalten, so dass man
den Eindruck gewinnt, die Stadt lebe in sich, ein wenig sich darbietend und ein
wenig mehr sich verhüllend, aber lebe.
Ein Reisebegleiter aus Pompeji berichtet uns, wie die Stadt im Jahre 97 nach Christi starb, spricht von einem Auswurfpilz, einer Säule wie ein Baum, und in 29 Kilometer Höhe habe sich der Schirm des Pilzes befunden. Zu den hoch in den Himmel schlagenden Flammen sei eine riesige schwarze Wolke gekommen, die die Sonne verfinstert habe. Ein dichter Regen aus Lavagestein habe sich über die Stadt, die damals 20 000 Einwohner gezählt hätte, gesenkt. Dächer und Mauern wären eingestürzt. Viele der Flüchtenden wären von Giftgasen getötet worden. Jene etwa 5000 Menschen, die in Kellern abzuwarten gedachten, wären umgekommen. Blitze, Erdbeben und Seebeben hätten dieses schreckliche Geschehen begleitet. Das höllische Entsetzen habe drei Tage gedauert, dann sei alles still geworden, ganz still.
Wie ähnlich dem Geschehen im Jahre 1945 in Dresden, denke ich, während ich auf Jahrtausende alten Steinen laufe. Nur geschah die Zerstörung meiner Stadt nicht durch eine Naturkatastrophe, sondern durch eine, die Menschen bereiteten. Doch auch Dresden war drei Tage und drei Nächte die Hölle, der Himmel glühte rot, Rauchwolken verhüllten die Sonne, und Zeitzünderbomben explodierten in der brennenden Stadt. Dann wurde alles still, ganz still.
In bläulicher Sanftheit, unweit von hier, der Vesuv. Nicht ganz berechenbar. Nicht ganz berechenbar auch die Menschen und jene Gewalten, die sie erfinden und nicht mehr beherrschen. Winzige weiße Wolken nun im Himmelsblau.
Ein Reisebegleiter aus Pompeji berichtet uns, wie die Stadt im Jahre 97 nach Christi starb, spricht von einem Auswurfpilz, einer Säule wie ein Baum, und in 29 Kilometer Höhe habe sich der Schirm des Pilzes befunden. Zu den hoch in den Himmel schlagenden Flammen sei eine riesige schwarze Wolke gekommen, die die Sonne verfinstert habe. Ein dichter Regen aus Lavagestein habe sich über die Stadt, die damals 20 000 Einwohner gezählt hätte, gesenkt. Dächer und Mauern wären eingestürzt. Viele der Flüchtenden wären von Giftgasen getötet worden. Jene etwa 5000 Menschen, die in Kellern abzuwarten gedachten, wären umgekommen. Blitze, Erdbeben und Seebeben hätten dieses schreckliche Geschehen begleitet. Das höllische Entsetzen habe drei Tage gedauert, dann sei alles still geworden, ganz still.
Wie ähnlich dem Geschehen im Jahre 1945 in Dresden, denke ich, während ich auf Jahrtausende alten Steinen laufe. Nur geschah die Zerstörung meiner Stadt nicht durch eine Naturkatastrophe, sondern durch eine, die Menschen bereiteten. Doch auch Dresden war drei Tage und drei Nächte die Hölle, der Himmel glühte rot, Rauchwolken verhüllten die Sonne, und Zeitzünderbomben explodierten in der brennenden Stadt. Dann wurde alles still, ganz still.
In bläulicher Sanftheit, unweit von hier, der Vesuv. Nicht ganz berechenbar. Nicht ganz berechenbar auch die Menschen und jene Gewalten, die sie erfinden und nicht mehr beherrschen. Winzige weiße Wolken nun im Himmelsblau.
13. SEPTEMBER 1992
Im Morgendunst zum Hafen. Das Wasser, mattgolden. Weiße Möwen um weiße Schiffe
kreisend. Das Tragflächenboot scheint vollbesetzt. Wir drängen die Treppe
hinauf zum Oberdeck. Es riecht nach Fischen und Meer. Auf den Seitenbänken
italienische Familien mit Kindern, dunkelhaarigen, brünetten, blonden. Als das
Schiff an Fahrtempo gewinnt und kühler Wind die Haare fleddert, ziehen Mütter
und Großmütter den Kleinen Jacken über und setzen ihnen Wollmützen oder
Kopftücher auf.
Schön auch, wie die Italiener über dem Geländer lehnen, die Köpfe auf die Arme gestützt, üppiges langes Haar flattert, als tanze es vor dem dunstigen Meer. Schon lange um uns nur Wasser und Himmel, ineinander verschwimmend. Aufspritzendes weißes Wasser, nahe dem Schiff, das längst nicht mehr gleitet, sondern zu fliegen und nur hin und wieder die Wasseroberfläche zu berühren scheint. Langsamer fährt das Schiff. Wir nähern uns der Insel, von der man sagt, sie sei die schönste der Welt.
 Capri. Wachsend aus blassblauem Meer hoch zum
Himmelsblau, kalkige Felsengebirge. Auf bewaldeten Berghängen, winzig, weiße
und rosa Villen, und vor uns, ineinandergewoben zum heiteren Bild, die
weißbunten Boote vor der weißbunten Stadt.
Capri. Wachsend aus blassblauem Meer hoch zum
Himmelsblau, kalkige Felsengebirge. Auf bewaldeten Berghängen, winzig, weiße
und rosa Villen, und vor uns, ineinandergewoben zum heiteren Bild, die
weißbunten Boote vor der weißbunten Stadt.
Mit zittrigen Schritten betrete ich ein Gemälde von Derain, kühl in der Komposition, satt in den Farben, trete ein in die lichtflimmernde Welt französischer Impressionisten und Fauvisten, deren Bilder, reproduziert in Büchern, anzusehen uns in der Studienzeit verboten war. Ich schaue Utrillos Komposition einer Stadt, Cesannes Farben der Hänge, die Stilleben von Matisse, die Hafenbilder Vlamincks. Eine Welt, immer jenseits aller Wirklichkeit, wird anfassbar wahr? Unbeweglich, stumm vor innerer Bewegung, versucht man, herauszutreten aus Bildern, die andere malten und die für uns - viele Künstler der DDR - Leben waren, in die wir uns banden. Auszutreten, um die Wirklichkeit zu begrüßen und einzutreten in sie, die noch nicht künstlerisch geordnete, um sie zu ordnen zum neuen, eigenen Bild! Doch da brauchte es Zeit, um malen zu können. Und nicht nur Zeit. Über die Hälfte des Lebens bedeuteten Bilder „Welt“, die verschlossen war. Sie öffnet sich nicht einfach, wenn man sie betritt. Es ist, als würde angesichts der Wirklichkeit gelebte Bild-Welt zu einer Last, die man nun - man weiß nicht, wie - ablegen müsste, um hier anzukommen.
Eine kleine Gaststätte mit Terrasse und Blick aufs Meer. Tischchen mit Stühlen unter Sonnenschirmen. Köstlich, der Kaffee! Von stillem Zauber die Zypressenlandschaft uns zu Füßen. Ich glaube fest, es müssen glückliche Menschen gewesen sein, die Capri erfanden, glückliche und künstlerisch empfindende. Wie andere Menschen Bilder komponieren, komponierten sie eine lebende Welt. In dieser zu sitzen - es ist Wirklichkeit. Wir wollten Anacapri, besuchen, wir werden es nicht tun. Vielleicht werden wir Anacapri später sehen, vielleicht nie. Man muss, so denke ich, Stille in sich fallen lassen, sich in Stille fallen lassen. Nur dann kann ganz im Inneren - als Gegengewicht zur Sehnsucht - ein Ankommen wachsen.
Schön auch, wie die Italiener über dem Geländer lehnen, die Köpfe auf die Arme gestützt, üppiges langes Haar flattert, als tanze es vor dem dunstigen Meer. Schon lange um uns nur Wasser und Himmel, ineinander verschwimmend. Aufspritzendes weißes Wasser, nahe dem Schiff, das längst nicht mehr gleitet, sondern zu fliegen und nur hin und wieder die Wasseroberfläche zu berühren scheint. Langsamer fährt das Schiff. Wir nähern uns der Insel, von der man sagt, sie sei die schönste der Welt.
 Capri. Wachsend aus blassblauem Meer hoch zum
Himmelsblau, kalkige Felsengebirge. Auf bewaldeten Berghängen, winzig, weiße
und rosa Villen, und vor uns, ineinandergewoben zum heiteren Bild, die
weißbunten Boote vor der weißbunten Stadt.
Capri. Wachsend aus blassblauem Meer hoch zum
Himmelsblau, kalkige Felsengebirge. Auf bewaldeten Berghängen, winzig, weiße
und rosa Villen, und vor uns, ineinandergewoben zum heiteren Bild, die
weißbunten Boote vor der weißbunten Stadt.
Mit zittrigen Schritten betrete ich ein Gemälde von Derain, kühl in der Komposition, satt in den Farben, trete ein in die lichtflimmernde Welt französischer Impressionisten und Fauvisten, deren Bilder, reproduziert in Büchern, anzusehen uns in der Studienzeit verboten war. Ich schaue Utrillos Komposition einer Stadt, Cesannes Farben der Hänge, die Stilleben von Matisse, die Hafenbilder Vlamincks. Eine Welt, immer jenseits aller Wirklichkeit, wird anfassbar wahr? Unbeweglich, stumm vor innerer Bewegung, versucht man, herauszutreten aus Bildern, die andere malten und die für uns - viele Künstler der DDR - Leben waren, in die wir uns banden. Auszutreten, um die Wirklichkeit zu begrüßen und einzutreten in sie, die noch nicht künstlerisch geordnete, um sie zu ordnen zum neuen, eigenen Bild! Doch da brauchte es Zeit, um malen zu können. Und nicht nur Zeit. Über die Hälfte des Lebens bedeuteten Bilder „Welt“, die verschlossen war. Sie öffnet sich nicht einfach, wenn man sie betritt. Es ist, als würde angesichts der Wirklichkeit gelebte Bild-Welt zu einer Last, die man nun - man weiß nicht, wie - ablegen müsste, um hier anzukommen.
Eine kleine Gaststätte mit Terrasse und Blick aufs Meer. Tischchen mit Stühlen unter Sonnenschirmen. Köstlich, der Kaffee! Von stillem Zauber die Zypressenlandschaft uns zu Füßen. Ich glaube fest, es müssen glückliche Menschen gewesen sein, die Capri erfanden, glückliche und künstlerisch empfindende. Wie andere Menschen Bilder komponieren, komponierten sie eine lebende Welt. In dieser zu sitzen - es ist Wirklichkeit. Wir wollten Anacapri, besuchen, wir werden es nicht tun. Vielleicht werden wir Anacapri später sehen, vielleicht nie. Man muss, so denke ich, Stille in sich fallen lassen, sich in Stille fallen lassen. Nur dann kann ganz im Inneren - als Gegengewicht zur Sehnsucht - ein Ankommen wachsen.